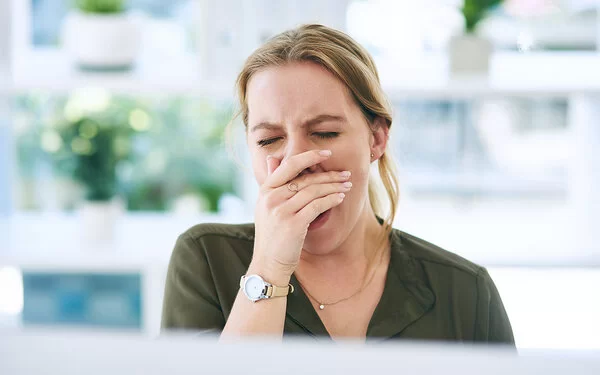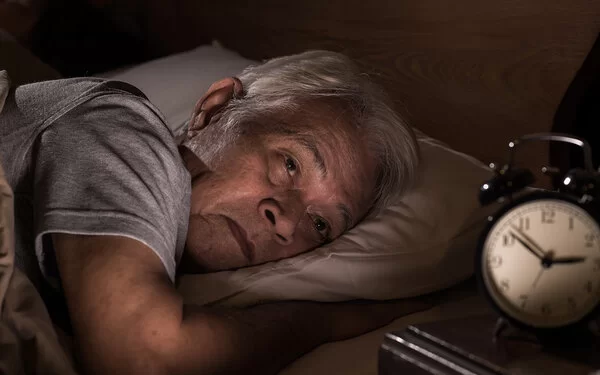Schlaf
Gefangen im Albtraum: Wie kommt es zu einer Schlafparalyse?
Veröffentlicht am:10.08.2022
4 Minuten Lesedauer
Eine Schlafparalyse ist ungefährlich – fühlt sich aber für Betroffene so an, als wären sie lebendig im Albtraum gefangen: Während der Geist wach ist, bleibt der Körper gelähmt. Was steckt hinter dem Phänomen – und wie lässt sich ihm vorbeugen?

© iStock / AndreyPopov
Was ist eine Schlafparalyse?
Während des Schlafs durchlaufen Menschen verschiedene Schlafstadien, und das mehrmals pro Nacht: Die erste Phase ist der Übergang vom Wachzustand in den Schlaf, in der zweiten Phase des leichten Schlafs entspannt sich die Muskulatur, in der dritten findet der Tiefschlaf statt. Danach folgt der sogenannte REM-Schlaf („Rapid-Eye-Movement-Schlaf“). In dieser Phase lassen sich kurze, rasche Augenbewegungen beobachten, die Hirnaktivität ist erhöht, Träume setzen ein. Damit es in diesem Stadium nicht zu unkontrollierten Bewegungen kommt und die geträumten Bewegungen nicht tatsächlich ausgeführt werden, setzt in der Skelettmuskulatur eine Lähmung ein, die aber nicht verkrampft, sondern schlaff ist. Ausgenommen ist zudem die Augen- und die Atmungsmuskulatur. Diese Lähmung wird sofort beendet, wenn man erwacht. Dauert diese Lähmung jedoch bis in den Wachzustand an, spricht man von einer Schlafparalyse. Sie definiert die Unfähigkeit, beim Einschlafen oder Aufwachen willkürliche Bewegungen auszuführen: Während das Bewusstsein schon vollständig da ist, fühlen sich Betroffene gelähmt. Aus diesem Grund wird die Schlafparalyse auch Schlaflähmung genannt.
Die Bewegungsunfähigkeit kann direkt zu Beginn des Schlafes oder aus dem Schlaf heraus eintreten. Meistens tritt sie in Rückenlage kurz vor dem endgültigen Aufwachen auf und dauert wenige Sekunden bis einige Minuten lang an. Sie betrifft entweder die gesamte Skelettmuskulatur oder auch nur Teile davon; lediglich Augen- und Atembewegungen können durchgeführt werden. Übersetzt bedeutet das: Betroffene können sich weder bewegen noch sprechen, in manchen Fällen funktionieren gurgelnde oder stöhnende Laute – mehr nicht.
Symptome einer Schlafparalyse: Wie fühlt sich die Schlaflähmung an?
Für die meisten Menschen ist die Schlaflähmung eine sehr unangenehme Erfahrung. Sie ist häufig eine Kombination aus Atonie (fehlende Spannung in der Muskulatur) und einem Albtraum. Schlafparalysen können auch mit Angstattacken einhergehen. Patientinnen und Patienten fühlen sich hilflos und bilden sich ein, nicht atmen zu können. Obwohl die Atmung von der Paralyse unbeeinflusst ist, da die Zwerchfellatmung aufrechterhalten bleibt, ist die Atemhilfsmuskulatur (wie etwa die Bauchmuskulatur) ohne Spannung. Das verursacht ein Gefühl von Atemnot.
Können Schlafparalysen Halluzinationen auslösen?
Bei etwa einem Drittel der Patienten gehen Schlaflähmungen mit visuellen, taktilen oder akustischen Halluzinationen einher. Auch eine imaginierte bedrohliche Präsenz im Raum, körperliche oder sexuelle Übergriffe können wahrgenommen werden.
Ist die Erkrankung nur leicht ausgeprägt, treten die Attacken in der Regel seltener als einmal pro Monat auf. Bei der schweren Form von Schlafparalyse tritt die Schlaflähmung mehrmals pro Woche ein, in manchen Fällen auch mehrmals pro Nacht. Eine Schlafparalyse kann aber auch ein einmaliges Erlebnis sein.

© iStock / PeopleImages
Ursachen: Diese Faktoren können Auslöser einer Schlafparalyse sein
Einer amerikanischen Studie aus dem Jahr 2016 zufolge ist davon auszugehen, dass 7,6 Prozent der Allgemeinbevölkerung im Laufe ihres Lebens mindestens einmal eine Schlafparalyse erlebt haben. Frauen scheinen dabei etwas häufiger als Männer betroffen zu sein.
Es gibt keine einzelne Ursache für die Schlafparalyse und ein (erstmaliges) Auftreten ist in jedem Alter möglich. Verschiedene Faktoren und Vorerkrankungen können die Attacken jedoch begünstigen:
- Schlafentzug
- unregelmäßiger Schlaf-wach-Rhythmus (beispielsweise durch Jetlag oder Schichtarbeit)
- Stress
- Krampfanfälle, vor allem in der Beinmuskulatur
- affektive Störungen wie etwa Depressionen
- Einnahme von Anxiolytika (Medikamente gegen Angststörungen)
- Ängste, psychischer Stress
- Panikstörungen
- ein hoher Neurotizismus-Score (erhöhte Neigung zu unter anderem Nervosität, Unsicherheit, Reizbarkeit)
Schlaflähmungen können auch ein Symptom einer Narkolepsie sein – eine Erkrankung, bei der es zu Störungen der Regulierung der Schlafphasen kommt. Ungefähr ein Viertel der an Narkolepsie Erkrankten leidet auch unter Schlaflähmungsattacken. Treten Schlafparalysen gehäuft auf, ist es daher notwendig, fachärztlich untersuchen zu lassen, ob eine Narkolepsie vorliegt.
Passende Artikel zum Thema
Schlafparalyse – was tun?
In den meisten Fällen ist keine Therapie nötig, da nur wenige Patientinnen und Patienten Belastungen oder Beeinträchtigungen im Alltag und sozialem oder beruflichen Leben erfahren. Es existieren keine Behandlungsmöglichkeiten der Schlafparalyse, die wissenschaftlich belegt sind. Ein erster Schritt ist es, sich als Betroffene oder Betroffener bewusst zu machen, dass es sich bei der Schlaflähmung um keine bösartige Erkrankung handelt. Die Erfahrung ist unangenehm und kann Angst machen, hat aber im Hinblick auf die körperliche Gesundheit keine negativen Auswirkungen – vorausgesetzt, es handelt sich um die leichte Ausprägung der Erkrankung. Wenn die Paralysen so stark ausgeprägt sind, dass die Schlafgesundheit gravierend beeinträchtigt ist, kann medikamentös versucht werden, mit Antidepressiva den REM-Schlaf zu unterdrücken oder auf Medikamente gegen Narkolepsie zurückzugriffen werden.
Folgende Maßnahmen können Schlaflähmungen vorbeugen:
- Schlafhygiene mit genügend Schlaf und regelmäßigen Schlafenszeiten
- Durchführen von Stressbewältigungsstrategien
- gedimmtes Licht am Bett
- Vermeiden der Rückenlage
Praktische Tipps
- Falls Sie in einer Partnerschaft leben, können Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin auf Ihre Erkrankung hinweisen und Signalgeräusche vereinbaren, wie etwa ein Grunzen oder Stöhnen, um im Falle einer Schlafparalyse auf sich aufmerksam zu machen.
- Üben Sie, während Ihrer Einschlafphasen den kleinen Finger oder die ganze Hand zu bewegen. So können Sie trainieren, diese Aktion auch während einer Schlafparalyse durchzuführen, die dadurch abgebrochen werden kann. Gleiches gilt für das Rollen der Augen.