Religion
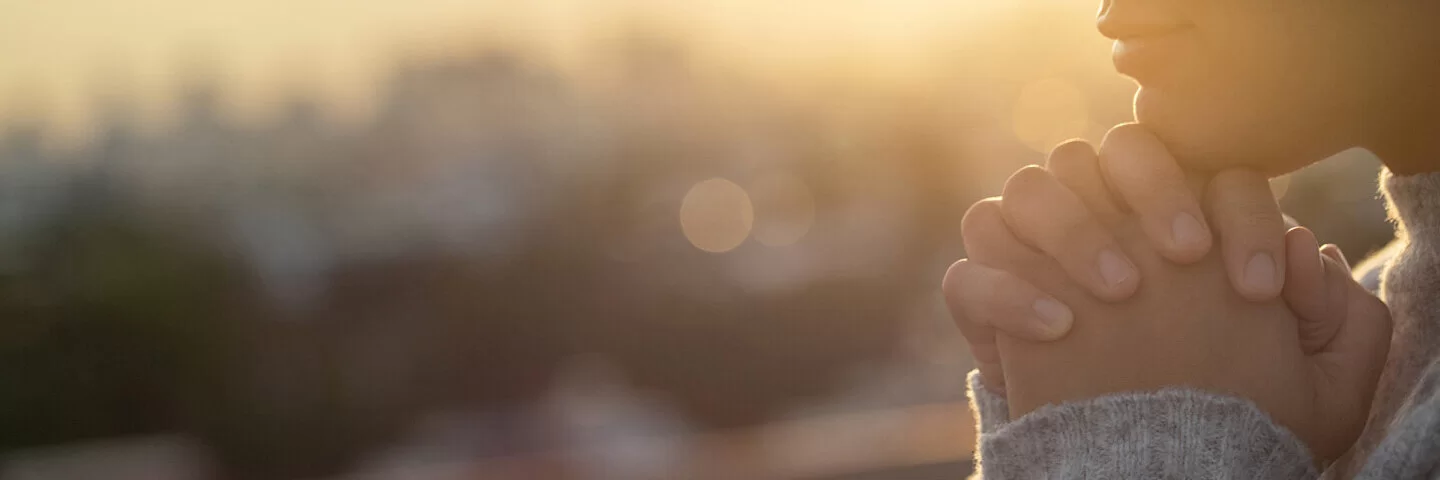
Inhalte im Überblick
Wie weit darf Medizin sich in den natürlichen Verlauf des Lebens einmischen?
Der Mensch darf sich in den natürlichen Verlauf einmischen. Die Organtransplantation hat das Ziel, den natürlichen Verlauf des Lebens zu bewahren oder wiederherzustellen.
Der natürliche Verlauf des Lebens ist durch Krankheiten bedroht. Der Mensch darf einem Erkrankten helfen beziehungsweise sein Leben retten. Voraussetzung ist, dass er damit nicht gegen dessen Willen handelt oder dessen Würde verletzt oder einem anderen Menschen schadet. Medizinische Behandlungen, zu denen auch die Organtransplantation gehört, haben das Ziel, das Leben so weit wie möglich und sinnvoll zu bewahren.
Welche Rolle spielt der religiöse Glaube bei der Spende von Organen?
Das Gebot zur Hilfeleistung und Solidarität gibt es im Christentum, Islam, Judentum und in anderen Glaubensrichtungen. Daraus ergibt sich jedoch keine religiöse Pflicht zur Organspende, denn die Entscheidung darüber obliegt dem Einzelnen.[1, 5] Aus christlicher Sicht gibt es keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Organentnahme. In Teilen des Islams bestehen Vorbehalte gegen die Organentnahme.
Der Zentralrat der Muslime in Deutschland allerdings begrüßte 1997 die Verabschiedung des Transplantationsgesetzes unter Berücksichtigung bestimmter islamischer Vorschriften. Nach jüdischem Glauben wird der Hirntod nicht mit dem Tod des Menschen gleichgesetzt. In Teilen des Judentums gibt es daher Vorbehalte gegen die Organentnahme. Das oberste Rabbinat in Israel billigt aber das Hirntodkriterium im Zusammenhang mit der Organtransplantation.
Die Religion eines Menschen prägt seine Einstellung zum Tod und zum eigenen Körper.[1] Zugleich wird seine Einstellung aber auch durch individuelle Erfahrungen und Lebensanschauungen bestimmt. Daher ist die persönliche Einstellung religiöser Menschen nicht unbedingt mit der offiziellen Lehrmeinung einer Religionsgemeinschaft gleichzusetzen.
Christentum
Islam
Judentum
Buddhismus
Welche Rolle spielt der religiöse Glaube beim Empfang eines Organs eines toten Menschen?
Aus christlicher Sicht bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, sich ein Organ eines fremden Menschen einpflanzen zu lassen, um das Leben zu erhalten oder die Leiden an einer schweren Krankheit zu mindern. Die Identität und Integrität des Menschen als Person wird damit nicht angetastet.
In großen Teilen des Islams und im orthodoxen Judentum bestehen Bedenken gegen den Empfang eines fremden Organs.
Wie weit geht die Nächstenliebe in Bezug auf die Organspende?
Eine Pflicht zur Organspende lässt sich aus dem Gebot der Nächstenliebe nicht ableiten.[5] Nächstenliebe ist aus christlicher Sicht ein übergeordnetes Gebot. Manche Menschen sehen die Organspende nach dem Tod als Akt der Nächstenliebe. Gegen diese Sichtweise spricht, dass keine persönliche Beziehung zwischen Spender und Empfänger besteht, da die Vermittlung von Spenderorganen in Deutschland anonym organisiert ist. Nächstenliebe setzt ein persönliches Verhältnis zwischen zwei lebenden Menschen voraus. Eine Pflicht zur Organspende lässt sich aus dem Gebot der Nächstenliebe daher nicht ableiten.
Verbund von Körper und Seele: Geht ein Stück meiner Seele verloren, wenn ich ein Organ spende?
Die Seele ist nach christlichem Glauben nicht an einzelne Organe gebunden. Die Entnahme von Organen führt daher nicht zum Verlust eines Teils der Seele.
Die Seele wird im christlichen Glauben als das belebende Innerste des Körpers, als das Zentrum, die Identität und das Wesen des Menschen betrachtet. Die Seele drückt sich in der gesamten Leiblichkeit aus. Die Entnahme eines einzelnen Organs oder mehrerer Organe nach dem Tod führt aber nicht zum Verlust eines Teils der Seele.
Dennoch empfinden manche Menschen, dass sich die Seele in den Organen in unterschiedlicher Stärke widerspiegelt. Vor allem das Herz wird vielfach als gefühlsmäßiges Zentrum empfunden. Aus diesem Grund lehnen manche Menschen eine Spende ihres Herzes ab.
Inhaltlich verantwortlich
Prof. Dr. Ulrich Eibach
Universität Bonn
Fachbereich Systematische Theologie und Ethik
Pfarrer am Universitätsklinikum Bonn
Erklärung zur Unabhängigkeit unserer Experten (PDF, 503 KB)
Erstellt am: 12.03.2012
Aktualisiert am: 01.04.2017
[1] Nagel, Alber, Bayerl (2011) Transplantationsmedizin zwischen Fortschritt und Organknappheit. Geschichte und aktuelle Fragen der Organspende, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 20–21: 15–21
[2] Deutsche Bischofskonferenz und Rat der Evangelischen Kirchen in Deutschland (1990) Organtransplantationen, Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der EKD. www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/gem-texte/GT_01.pdf (Zugriff 15.05.2017)
[3] Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V. (2010) Stellungnahme zum Gesetzesentwurf zur Änderung des Transplantationsgesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2010 / 53 / EU über Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur Transplantation bestimmte menschliche Organe. zentralrat.de/18035.php. (Zugriff am 15.05.2017)
[4] Holznienkemper, T. (2005) Organspende und Transplantation und ihre Rezension in der Ethik der abrahamitischen Religionen; LIT Verlag
[5] Deutsche Bischofskonferenz in Deutschland. Hirntod und Organspende. Bonn 2015. 29 S. (Die deutschen Bischöfe – Glaubenskommission ; 4 1)
Waren diese Informationen hilfreich für Sie?
Das könnte Sie auch interessieren
Menschenwürde und Organspende
Entscheidungshilfe Organspende für Angehörige
Hirntoddiagnostik und Organspende